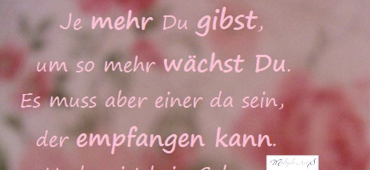4 Min. Lesezeit
Mama hat MS - Auswirkungen auf die eigenen Kinder

Selbst MS haben: schlimm genug! Aber noch schlimmer ist die Angst vor allen Auswirkungen der Erkrankung auf die eigenen Kinder.
Fast drei Jahre sind nun um – drei Jahre, die nicht mehr „vorher“ oder „früher“ sind. Drei gedankenreiche Jahre, drei Jahre mit einer anderen Sichtweise auf das Leben, aber auch drei Jahre der Fragen: drei Jahre mit MS.
Nachdem zu Beginn der Diagnoseverarbeitung mein Gedankenkarussell fast egozentrisch war, habe ich beobachtet, dass meine Fragen sich immer weiter von mir weg hin zu meiner Familie, meinen Kindern und deren Zukunft verlagern. Dabei sind es zwei Punkte, die mich am meisten umtreiben:
1. Falls meine MS-Symptome schlimmer werden sollten – wird meine Familie darunter leiden und wenn ja, in welcher Form?
2. Die erbliche Komponente. Nun bin ich, soweit es mir bekannt ist, der erste Mensch in meinem Familienstammbaum, bei dem MS diagnostiziert wurde. Ich habe sie „eingeschleppt“. Gibt es wirklich nur eine minimale erbliche Komponente oder sind meine Jungs einer schwebenden zukünftigen Gefahr ausgesetzt?
Müssen meine Kinder unter meiner MS leiden, wenn sie schlimmer wird?
Kinder wünschen sich eine gesunde, fröhliche Mutter, mit der man Pferde stehlen könnte, die alles mitmacht und für jeden Spaß zu haben ist. Seit den letzten drei Jahren bin ich eben dies deutlich seltener. Öfter als andere Mütter muss ich wilde Tobespiele ablehnen oder sie einfach viel früher beenden.
Mein großer Sohn nimmt auch noch andere Sachen wahr, auf seine kindliche Art sagt er Sachen wie: „Ich muss nur ganz selten Pipi – und dann kommt ganz viel, weil meine Blase so groß ist. Du musst bestimmt so oft Pipi, weil deine Blase viel kleiner ist.“ Das ist eine niedliche Erklärung, aber sie zeigt auch: Meine erzwungen veränderte Lebensführung bleibt den Kindern nicht verborgen. Jetzt sind es Symptome, die ich noch gut handeln kann. Doch wer weiß, was noch kommt? Müssen sich die Kinder, wenn sie Teenager sind, für ihre Mutter schämen? Weil sie „peinliche“ Sachen macht wie komische Bewegungen oder weil sie keine tollen Worte mehr sagen kann? Klar, sie sollen lernen, dass jeder Mensch gut ist, so wie er ist. Aber ich glaube, dass Teenager da anders ticken und dass potenzielle MS-Symptome in dieser Zeit eine Belastung für sie sein könnten.
Oder werde ich die Mutter sein, die später, im Studium, nie zu Besuch kommt, weil sie die weite Anfahrt nicht mehr schafft? Oder die schon lange arbeitsunfähig ist und somit nicht „mal eben“ den rettenden Fünfziger zustecken kann, wenn es zum Monatsende knapp wird? Es sind viele kleine Sorgen darüber, unter welchen Auswirkungen der hässlichen MS meine Kinder später leiden könnten.
Noch schlimmer: Sind meine Kinder selbst von MS bedroht?
Dieser Gedanke ist so schlimm, dass ich ihn eigentlich wegschiebe, sobald er auftaucht. Denn die Vorstellung, dass meine Kinder schwer und unheilbar krank werden könnten, ist unerträglich für mich. Und ja: Die Gefahr, dass sie ebenfalls an Multipler Sklerose erkranken könnten, ist tatsächlich erhöht. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) schreibt dazu, dass es zwei Faktoren gebe, die Auswirkungen auf die Entwicklung von MS haben. Der eine sei exogen, also etwa ein Virus, dem man in der Vergangenheit ausgesetzt war – in meinem Fall war dies übrigens tatsächlich der Epstein-Barr-Virus, also „Pfeiffersches Drüsenfieber“. Der andere Faktor sei, so die DMSG, endogen. Das bedeutet, dieser ist in einem individuellen Menschen vorhanden und macht ihn anfällig für MS, etwa durch eine bestimmte Kombination der Erbanlagen.
Sofern Familienmitglieder beide Faktoren mitbrächten, sei das MS-Risiko innerhalb dieser Familie leicht erhöht – sodass in vier Prozent der MS-Familien mehr als eine Person betroffen sei. Somit sei aber lediglich von einer erhöhten „Empfänglichkeit“, nicht aber von einer Vererbung im klassischen Sinne die Rede.
Trotzdem: Auch eine erhöhte „MS-Empfänglichkeit“ ist mir eigentlich zu viel für meine Kinder. Zwar ziehe ich zur Beruhigung gerne den ausgleichenden Fakt hinzu, dass MS statistisch betrachtet bei Frauen etwa drei- bis viermal häufiger vorkommt als bei Männern. Warum das so ist, liegt – wie so vieles rund um das Mysterium MS – im Dunkeln. Dennoch ist dieser Fakt mein Hoffnungsschimmer für meine beiden Söhne. Was kann ich sonst tun? Ich kann ihnen Vitamin D geben, denn es sei möglich, dass das Entstehen einer MS mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel zu tun habe. Ich kann sie anhalten, ein aktives und sportliches Leben zu führen, um der Autoimmunkrankheit einen starken und fitten Körper entgegenzusetzen. Sie können außerdem lernen, dass auch Menschen mit Einschränkungen liebenswert sind.
Ich kann meine etwas stärker gefährdeten Kinder nicht vor der MS schützen. Aber ich kann alles dafür tun, aus ihnen Erwachsene voll Selbstvertrauen zu machen. Die der MS – oder was auch immer da kommen mag – mutig und stark entgegentreten können.
MAT-DE-2006695-2.0-09/2023
Weitere Beiträge
Sie verlassen die Website von MS Begleiter
Sie werden auf eine Drittanbieter-Website weitergeleitet:
Dieser Link wird zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass diese Drittanbieter-Website weder von MS Begleiter kontrolliert wird noch unseren Datenschutzbestimmungen unterliegt.
Vielen Dank für Ihren Besuch unserer Website. Wir hoffen, dass Ihr Besuch informativ und unterhaltsam war.