Ein wichtiger Helfer, den wir oft vergessen: Routine.
4 Min. Lesezeit
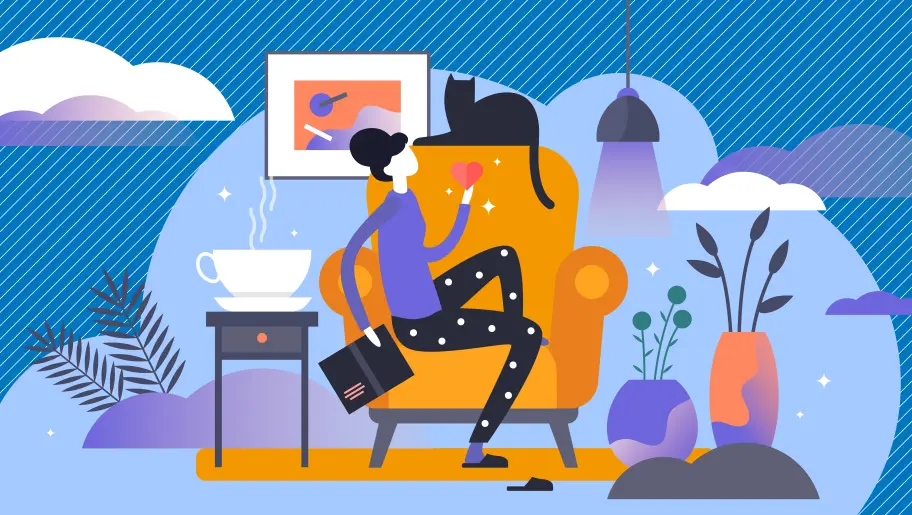.webp)
Unsere täglichen Routinen gehören zum Leben wie das Atmen oder der Schlaf. Doch wie entstehen sie eigentlich? Und warum kann es wichtig sein, die eigene Routine von Zeit zu Zeit zu hinterfragen?
Wer Fahrradfahren gelernt hat, kennt das Phänomen: Kaum denkt man darüber nach, was man da eigentlich gerade tut, wird die Fahrt schnell wackelig. Nur mit der nötigen Routine kommen wir auf dem Zweirad sicher voran.
Dabei ist die Kunst des Radfahrens nur eine von zahllosen Routinen, über die wir nicht mehr nachdenken – wir handeln fast instinktiv, wenn wir eine Schleife binden, eine Tür öffnen oder uns anziehen. Wie unpraktisch und langsam wäre unser Leben, wenn wir jeden Morgen erst überlegen müssten, wie wir in eine Hose steigen oder welche Körperteile durch die Öffnungen in einem Pullover gesteckt werden müssen.
Der Grund für die Routine, die wir bei so vielen Dingen des Alltags entwickeln, liegt in der Evolutionsgeschichte begründet: Schon unsere Vorfahren in der Steinzeit mussten blitzschnell reagieren können, wenn sie einem Mammut oder einem Säbelzahntiger gegenüberstanden. Bräuchte unser Gehirn in solchen Situationen zig Denkschritte, um das Verhalten zu steuern, wäre es hoffnungslos überlastet. Und die ersten Menschen hätten sowohl zu lange gebraucht, um auf die Begegnung mit wilden Tieren noch angemessen zu reagieren und rechtzeitig die Flucht zu ergreifen.
Wissenschaftler der Kognitionspsychologie, die an der Universität Hamburg zu diesem Themengebiet forschen, erklären zusammenfassend:
„Wir alle treffen Tag für Tag unzählige Entscheidungen, von denen einige nur geringe Bedeutung, andere jedoch beträchtliche Konsequenzen für den Rest unseres Lebens haben. Effizientes Entscheiden ist in vielen Lebensbereichen zentral und Entscheidungsdefizite sind ein zentrales Kennzeichen verschiedener psychischer Störungen."1
Wiederholung macht den Meister.
Begegnen wir anderen Menschen, sind wir meist froh, wenn sie über jede Menge Routine verfügen. Wer möchte nicht lieber von einem erfahrenen Piloten in den Urlaub geflogen werden als von einem Anfänger, der noch wenig Erfahrung hat? Und wie würde eine Busfahrt in die Stadt wohl aussehen, wenn der Fahrer vor jeder Tour erst überlegen müsste, welche Pedale er wann mit seinen Füßen bedienen muss? Routine macht uns also oftmals das Leben leichter.
Angeboren sind diese Verhaltensmuster übrigens nicht – erst was wir oft wiederholen, wird irgendwann zur Routine. Ein Muster, das Kampfsportfans aus dem Filmklassiker „Karate Kid" kennen. Hier lässt der alte Karatelehrer Mr. Miyagi seinen Schützling Daniel LaRusso Tätigkeiten wie das Streichen eines Zauns stundenlang wiederholen. Als der junge Karateschüler sich schließlich beschwert, dass er bislang kein Karate gelernt hätte, zeigt ihm der Altmeister, wie jeder dieser Handgriffe durch die Wiederholung zu einer Routine geworden ist, die sich als Teil der Karatebewegungen entpuppt.
Nach 66 Tagen ist sie da – die Routine.
Auch die Wissenschaft hat das Phänomen der Routine untersucht: Die britische Forscherin Phillipa Lally vom University College London bat eine Gruppe Studierender, mindestens einmal im Lauf des Tages eine Angewohnheit zu pflegen, ganze 84 Tage lang.
Freigestellt war der Gruppe der 96 Versuchsteilnehmer dabei, was für eine Routine sie wählten – von einem Spaziergang über den Verzehr bestimmter Lebensmittel bis zu morgendlichem Frühsport war alles dabei. Am Ende waren es 82 Teilnehmer, die ihren Vorsätzen bis zum Ende treu blieben.
Durchschnittlich 66 Tage hatten die Studierenden dabei gebraucht, bis die neue Tätigkeit für sie eine Art Automatismus geworden war, über den sie nicht mehr nachdenken mussten. Auch ein ausgelassener Tag konnte sie dabei nicht von ihrer Routine abbringen.2
Die Schattenseiten der Routine.
So sehr Routine uns hilft, die täglichen Herausforderungen des Alltags zu bewältigen, so problematisch kann sie werden, wenn wir uns zu sehr an sie gewöhnen. Wer stundenlang eine monotone Tätigkeit in einer Fabrik ausführt, wird irgendwann unaufmerksam und kann einen Arbeitsunfall verursachen. Auch die berühmt-berüchtigten Weihnachtsgeschenke wie jährlich wiederkehrende Socken sorgen eher für Verstimmung unter dem Baum als für Freude. Und schließlich der Klassiker: Wer bei seiner Ernährung bestimmte Routinen entwickelt hat, kommt nur schwer wieder von den Chips vor dem Fernseher los.
Schon 2016 kommentierte das Wirtschaftsmagazin „brand eins" dieses Verhalten so: „Im Dezember 2016 nahmen sich 50 Prozent der Deutschen vor, mehr Sport zu treiben, 46 Prozent wollten abnehmen, 11 Prozent das Rauchen oder den Alkohol aufgeben. In der zweiten Januarwoche hatte ein Viertel der Menschen ihre Vorsätze aufgegeben."3
Routine ist wichtig. Aber nicht alles im Leben.
Auch in der Medizin ist Routine einerseits von Vorteil – etwa bei Operationen, bei denen die immer gleichen Handgriffe exakt ausgeführt werden müssen. Andererseits kann es sich lohnen, wenn Ärzte und ihre Patienten ihre eigenen Routinen von Zeit zu Zeit kritisch hinterfragen.
Gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse? Oder haben sich die Lebensumstände eines Patienten geändert? Natürlich ist es richtig, wenn eine einmal erfolgreiche Therapie oder andere medizinische Entscheidung fortgeführt wird. Doch nur wer auch einmal den Blick über den eigenen Tellerrand wagt, hat die Chance auf neue Erkenntnisse und Entdeckungen.
Und spannender ist das Leben allemal, wenn es nicht aus der Wiederholung der immer gleichen Routinen besteht. Es reicht ja schon, wenn man kleine Dinge im Alltag ändert, um die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen: Wer einmal statt mit dem Bus zu Fuß zur Arbeit geht, wird seinen Stadtteil mit anderen Augen wahrnehmen. Und wer sich in einer Beziehung nicht nur auf die bekannte Routine und ihre Rituale verlässt, hält seine Liebe leichter lebendig.
Quellen:
1 vergl. auch: www.psy.unihamburg.de/arbeitsbereiche/kognitionspsychologie/forschung/handlungs--und-entscheidungsprozesse.html; letzter Zugriff: 22.02.2022.
2 Lally, P., van Jaarsveld, C., Potts, H., and Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology DOI: 10.1002/ejsp.674.
3 www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2017/loslassen/ermuedungskampf-mit-dem-eigenen-gehirn; letzter Zugriff: 22.02.2022.
MAT-DE-2200831-1.0-03/2022


