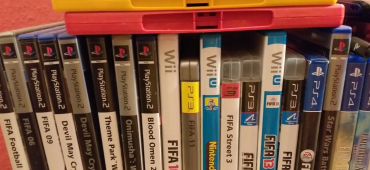5 Min. Lesezeit
Meine MS-Heldin: Ohne meine Heilpraktikerin wäre ich heute nicht da, wo ich bin.

Ich habe sie verflucht, beschimpft, ich habe geweint und mich in meinem Bett vergraben. Die Diagnose MS war ein Schock für mich. Zehn Jahre liegt sie nun zurück und heute kann ich wohlwollender auf sie blicken. Nicht, weil ich dankbar für sie bin. Auf keinen Fall. Aber weil ich ohne sie niemals die Menschen kennen und schätzen gelernt hätte, die mein Leben heute begleiten und reich machen.
Der Tag im März 2013 sollte mein Leben verändern: Ich saß gemeinsam mit meinem Vater am Schreibtisch eines Neurologen in meiner Heimatstadt. Er blickte mit gerunzelter Stirn auf seinen Computer und berichtete mir von der Diagnose und dem damit verbundenen Stigma, das ich fortan hatte: Multiple Sklerose, MS, eine unheilbare Autoimmunerkrankung. Bis zu diesem Tag wusste ich nicht einmal, dass es eine Krankheit mit diesem Namen gab und woher sie kam. Sie war einfach da. Und der Neurologe sagte, dass sie bleiben würde. Für immer.
Monatelang fühlte ich mich gezeichnet von seinen Worten. Ich war schwer krank, so meine Annahme. Ein normales Leben würde ich fortan nicht mehr führen können. Kinder und Familie? Wenn, dann so schnell wie möglich. Reisen? Nur noch höchstens sechs Tage lang. Denn am siebten Tag musste ich mir eine Spritze geben, nach der ich wie tot auf der Couch liegen würde. Von Kopfschmerzen und Schüttelfrost auf den Boden gezogen. Meinen Job weiter ausüben? Vermutlich musste ich jedem Arbeitgeber über diese Krankheit berichten. Über den Schwerbehindertenausweis, den ich fortan in meinem Geldbeutel mit mir herumtragen würde.
Zu dem Zeitpunkt im März 2013 war ich gerade in den letzten Wochen eines Volontariates bei der Tageszeitung meiner Heimatstadt. Ich liebte meine Arbeit. Fand es toll, jeden Tag andere Menschen kennenzulernen und von Termin zu Termin zu fahren. Die Diagnose machte mir Angst. Ich war gerade 21 Jahre alt, in wenigen Tagen war mein 22. Geburtstag und das Volontariat war bald vorbei. Danach wollte ich raus in die Welt, bei anderen Zeitungen arbeiten, in einer Großstadt leben. Das ging jetzt nicht mehr, oder?
Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an dem abends eine Krankenschwester in mein Elternhaus kam und mir zeigte, wie ich mir von nun an jeden Sonntag selbst eine Spritze in den Oberschenkel geben sollte. Es kann sein, dass meine Haut darunter leiden und an dieser Stelle verhärten würde, hat sie gesagt. Deshalb sollte ich ab und zu die Einstichstelle wechseln. Und ich sollte vor der Spritze Schmerzmittel nehmen. Denn es war wahrscheinlich, dass ich danach starke Kopfschmerzen bekommen würde.

Das konnte doch nicht mein Leben sein, dachte ich. So wollte ich nicht weitermachen. Ich wollte frei sein. Das tun, wozu ich Lust hatte. Und nicht bloß das, was man als schwerbehinderter Mensch tun sollte. Und genau hier, mit diesen Gedanken im Kopf, machte ich das Beste aus diesem schicksalhaften Tag im März 2013.
Ich nahm mein Leben selbst in die Hand, gab es nicht den Ärzten hin, ohne selbst darüber nachzudenken. Ich begann, im Internet über die Krankheit zu recherchieren. Darüber, was ich tun konnte, damit ich nicht das eben beschriebene Leben führen musste. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich fand heraus, dass das Immunsystem von der MS fehlgelenkt wird. Es greift irrtümlicherweise die isolierende Schutzhülle der Nervenzellfortsätze im Gehirn, Rückenmark und den Sehnerven an. Also musste man es doch bloß wieder auf den richtigen Weg bringen, oder?
Irgendwann brachte mich meine Mutter zu einer Frau in einem kleinen Dorf. Das Haus, in dem sie auch heute noch lebt und arbeitet, ist verwinkelt, umringt von einem großen Garten, in dem wilde Kräuter wachsen und Hühner gackern. Dass die Frau mit den weißen Haaren, die drinnen auf mich wartete, mein Leben verändern sollte, war mir noch nicht bewusst, als ich durch die schwere Holztür eintrat. Es gab Tee aus den wilden Kräutern im Garten. Die Möbel in der Praxis waren alle aus Holz und vor den Fenstern standen Blumen. Ich weiß noch, dass ich zu diesem Zeitpunkt schlecht sehen konnte. Deswegen hatte mich meine Mutter im Auto hergefahren.
Und sie blieb während der ganzen Behandlung da, machte sich Notizen, um später im Internet nachzulesen, was die Heilpraktikerin sagte. Ohne die Diagnose an besagtem Tag im März hätte ich sie nie kennengelernt. Wenn ich darüber nachdenke, würde ich das heute schade finden, denn sie hat mein Leben auf so viele unterschiedliche Arten verändert und bereichert.
Natürlich hat sie mir zum einen, was die Krankheit angeht, geholfen. Aber sie war auch in so vielen anderen Bereichen für mich da, hat mir zugehört, als es später mal beruflich nicht gut lief, und auch, als eine lange Beziehung in die Brüche ging. Wahrscheinlich habe auch ich mich durch den Kontakt zu ihr verändert.
Zurückblickend war ich ein anderer Mensch, bevor ich die Diagnose bekommen habe. Unachtsamer, was das Leben angeht. Durch sie habe ich eine Erkenntnis erhalten, auf die ich ohne die elendige Diagnose womöglich nie oder erst viel später gekommen wäre. Sie lautet: Alles, was in unserem Leben passiert, geschieht aus einem Grund. Das mag zuerst naiv und dumm klingen. Aber ich bin mir so sicher, dass mein Leben ohne die Diagnose heute ein ganz anderes wäre.
Das ist wie bei dem bekannten Schmetterlingseffekt. Wenn dieses Tier irgendwo auf der Welt mit dem Flügel schlägt, kann das unheimlich viel nach sich ziehen. Und genauso sehe ich das heute auch. Hätte ich damals an diesem Schreibtisch in der Praxis am Hauptbahnhof nicht die Diagnose erhalten, dann hätte ich meine Zelte in meiner Heimatstadt abgebrochen, wäre in die Welt gezogen, hätte Dinge getan, die mich das Leben hätten spüren lassen.
Das ist nun auf andere Weise geschehen. Es hat wehgetan. Es hat mich manchmal verzweifeln und meinen Körper hassen lassen. Aber es hat mich auch zu Menschen geführt, die sich meiner angenommen und mich ins Herz geschlossen haben. Nun lebe ich in einem Körper, auf den ich unglaublich stolz bin. Weil er funktioniert, wie ich es will – zumindest meistens. In einem Umfeld, das mich liebt. In einer Welt, auf die ich achtgebe. Ganz einfach, weil sie so schön und verletzlich ist – wie alle von uns.
Ja, ich glaube wirklich, dass wir das sind. Und deswegen müssen wir ganz besonders gut auf uns aufpassen. Auch das ist etwas, das mich meine Heilpraktikerin gelehrt hat, die ich ohne die Diagnose womöglich nie kennengelernt hätte. Wir müssen achtgeben auf uns und unsere Körper. Vielleicht noch mehr als andere Menschen, deren Leben ohne Autoimmunerkrankung verläuft. Aber ist das wirklich so schlimm? Hat man erstmal sein Denken darüber geändert, nicht. Zumindest sehe ich das so. Ich finde heute, nichts ist wichtiger als unsere Gesundheit. Sie ist ein hohes Gut, das wir eben beschützen müssen. Aber dafür werden wir belohnt.
_0.jpeg/jcr:content/image2(1)_0.jpeg 400w, /.imaging/webp/sanofi-platform/img-w500/dam/ms-begleiter-de/einblick-blog/suria/meine-ms-heldin-ohne-meine-heilpraktikerin-waere-ich-heute-nicht-da-wo-ich-bin/image2(1)_0.jpeg/jcr:content/image2(1)_0.jpeg 500w, /.imaging/webp/sanofi-platform/img-w600/dam/ms-begleiter-de/einblick-blog/suria/meine-ms-heldin-ohne-meine-heilpraktikerin-waere-ich-heute-nicht-da-wo-ich-bin/image2(1)_0.jpeg/jcr:content/image2(1)_0.jpeg 600w, /.imaging/webp/sanofi-platform/img-w700/dam/ms-begleiter-de/einblick-blog/suria/meine-ms-heldin-ohne-meine-heilpraktikerin-waere-ich-heute-nicht-da-wo-ich-bin/image2(1)_0.jpeg/jcr:content/image2(1)_0.jpeg 700w, /.imaging/webp/sanofi-platform/img-w800/dam/ms-begleiter-de/einblick-blog/suria/meine-ms-heldin-ohne-meine-heilpraktikerin-waere-ich-heute-nicht-da-wo-ich-bin/image2(1)_0.jpeg/jcr:content/image2(1)_0.jpeg 800w, /.imaging/webp/sanofi-platform/img-w900/dam/ms-begleiter-de/einblick-blog/suria/meine-ms-heldin-ohne-meine-heilpraktikerin-waere-ich-heute-nicht-da-wo-ich-bin/image2(1)_0.jpeg/jcr:content/image2(1)_0.jpeg 900w)
MAT-DE-2102287-1.0-05/2021
Weitere Beiträge
Sie verlassen die Website von MS Begleiter
Sie werden auf eine Drittanbieter-Website weitergeleitet:
Dieser Link wird zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass diese Drittanbieter-Website weder von MS Begleiter kontrolliert wird noch unseren Datenschutzbestimmungen unterliegt.
Vielen Dank für Ihren Besuch unserer Website. Wir hoffen, dass Ihr Besuch informativ und unterhaltsam war.

.jpg 370w)